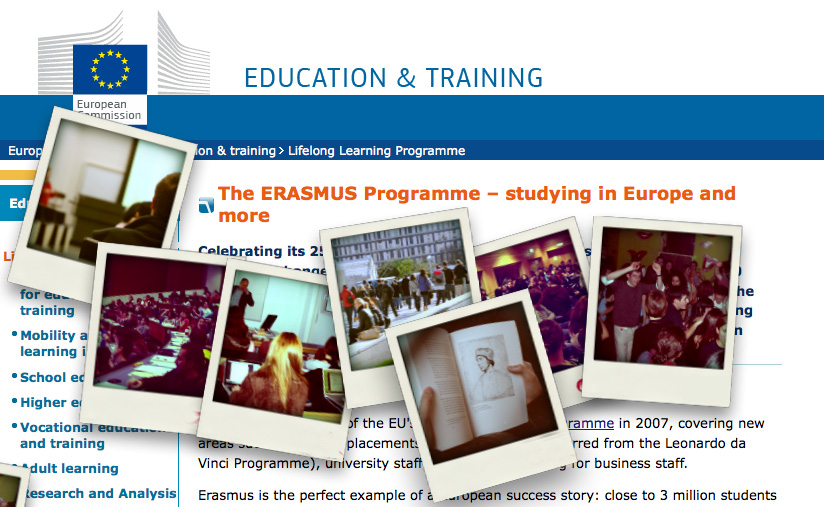SPÖ-Europaabgeordneter will rasche Novellierung der EU-Richtlinie
„Die Bedenken im Zuge der Vorratsdatenspeicherung scheinen sich nun nach und nach zu bewahrheiten“, sagt der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Er bezieht sich auf Aussagen des Vereins für Anti-Piraterie (VAP), der die Vorratsdaten nun auch im Zuge einer parlamentarischen Novelle 2013 für die Ausforschung von Verstößen bei Internet-Downloads von Filmen und Musik verwenden möchte. ****
Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, erläutert: „Wir sehen, wie fehlgeleitet die Richtlinie gestaltet worden ist, wenn jetzt sogar Vereine auf Daten zurückgreifen wollen, die ursprünglich ausschließlich für die Terrorismusbekämpfung vorgesehen waren.“ Der SPÖ-Europaabgeordnete fordert EU-Kommissarin Cecilia Malmström auf, die in ihrer Funktion als EU-Abgeordnete gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt hat, „die Novellierung der Richtlinie nicht weiter hinauszuzögern und auf die europaweit geäußerten Bedenken einzugehen“.
Beim Projekt Clean IT wird zu stark Rücksicht auf die Interessen der Industrie genommen, die Internet-Öffentlichkeit wurde nicht beteiligt. Das kritisiert Josef Weidenholzer, Europa-Abgeordneter der Sozialdemokratische Partei Österreichs im Interview mit futurezone.at. Zudem diene der Terrorismus nur als Vorwand, um neue Überwachungsmöglichkeiten zu schaffen:
Natürlich gibt es Gefahren, die wir nicht kennen, aber es gibt bereits eine Reihe von Instanzen, die sich damit beschäftigen. Es gibt beispielsweise die Europol, die sich mit Terrorismusbekämpfung auseinandersetzt. Bei “Clean IT” habe ich hingegen den Verdacht, dass man den Terrorismus nur vorschiebt, um viel mehr Kontrollmöglichkeiten in die Hand zu bekommen. Ich habe den Verdacht, dass das nicht ausschließlich von der Sache her zu rechtfertigen ist. Man hat die Instrumente dafür ja bereits. Der Verdacht liegt daher nahe, dass man sich etwas Anderes erwartet.
Das heißt, dass man mit einem Ausbau der Überwachung von Internet-Nutzern eigentlich andere Zwecke verfolgt?
Wir haben diese Erfahrung gemacht bei der Vorratsdatenspeicherung. Zunächst ist die Bekämpfung des Terrorismus im Mittelpunkt gestanden und man hat gemeint, dass man mittels solcher Daten terroristische Aktivitäten bekämpfen kann. Dann hat man mit diesen Daten aber nicht Terrorismus bekämpft, sondern hat die Daten für alle möglichen Straftaten herangezogen. Mittlerweile werden diese Daten in manchen Ländern wie Polen ganz exzessiv verwendet. Es können in Polen aber nicht zigtausende terroristische Aktivitäten stattfinden, die das rechtfertigen. Diese Gefahr sehe ich hier genauso, dass die Terrorismusabwehr nur als Vorwand herangezogen wird.
Hier gehts zum Artikel auf netzpolitik.org
Das ERASMUS Programm der EU fördert seit 1987 Studierende in ganz Europa und ermöglicht ihnen einen Aufenthalt im Ausland. Doch wie lange noch? Derzeit gerät ERASMUS unter erheblichen Druck. Nicht etwa politischen Druck, sondern unter rein budgetären Druck. ERASMUS geht spätestens Mitte 2013 das Geld aus.
Erfolgsprojekt
Erasmus ist eines der am längsten laufenden Programme der EU und auch eines der erfolgreichsten. Millionen von Studierenden in ganz Europa konnten so 3-12 Monate wichtige Erfahrungen machen und zusätzliche Kompetenzen im Ausland erwerben. Das diese Erfolgsgeschichte jetzt unter Druck gerät ist auch nicht auf politische Gründe zurückzuführen. Bis Anfang Oktober wurden schon alle Mittel des laufenden Jahres ausgegeben. Die restlichen 3 Monaten dieses Jahres werden aus dem Budget für 2013 bestritten – ab Mitte des nächsten Jahres fehlt dann das Geld.
Was fehlt konkret?
Das ERASMUS Programm ist Teil des „Lifelong Learning“ Programms (LLP) und macht etwas mehr als 40% des LLP’s aus. Für das nächste Jahr wären 1,14 Milliarden Euro für das LLP budgetiert, wovon 465 Millionen an ERASMUS gehen. Man geht davon aus, dass ca. 180 Millionen Euro fehlen, wovon 90 Millionen bei ERASMUS abgehen werden. Als eines der sichtbarsten und populärsten Programme der EU freut sich ERASMUS eines regen Andrangs. Daher wurden von den nationalen Agenturen, welche die Mittel der EU an die Studierenden verteilen, die Mittel schon Anfang Oktober ausgeschöpft.
Was heißt das für Studierende?
Bis zum Wintersemester 2013 werden Studierende ganz sicher keine Probleme mit den zugesagten Förderungen haben. Für das laufende Wintersemester werden die Gelder aus dem nächsten Jahr angezapft. Bisher wurden den nationalen Agenturen 70% des Budgets für 2012/13 überwiesen, derzeit wird in den einzelnen Ländern schon das Geld für das nächste Jahr verwendet.
Und für das Sommersemester 2013 ist auch auf jeden Fall genug Geld da. Sollte bis zum Sommer 2013 aber keine Lösung – in Form von 90 Millionen Euro zusätzlich – gefunden werden, könnte es zu Problemen beim Wintersemester 2013/14 kommen. Ein anderer Ansatz zur Lösung des Problems wäre das Einspringen der nationalen Regierungen.
Die Konsequenzen wären natürlich für viele Studierende katastrophal. Besonders bei einem Aufenthalt im Ausland ist die (finanzielle) Planbarkeit sehr wichtig. Da es jedoch sein könnte, dass Studierende für das Wintersemester 2013/14 nicht die volle zugesagte Summe an Förderungen bekommen, werden sie massiv in ihren Planungen gestört.
Ab 2014 „ERASMUS for All“
Die budgetären Probleme von ERASMUS sind umso verwunderlicher, wenn man die Planungen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmes der EU berücksichtigt. Während zwischen 2007 und 2013 das Budget für Lifelong Learning 7 Milliarden Euro betrug, werden es zwischen 2014 und 2020 ganze 19 Milliarden sein. Das stellt eine Erhöhung im Vergleich zum gesamten EU Budget von 0,71% auf 1,64% dar.
Statement zur Debatte im EU Parlament von Josef Weidenholzer:
Während meiner langjährigen Tätigkeit als Professor an einer österreichischen Universität konnte ich die Erfolgsgeschichte von Erasmus miterleben: wie die Studierenden von ihren Erasmus Aufenthalten mit mehr Weltoffenheit, Selbstbewusstsein, Motivation und einem positiven Bild von Europa zurückkehrten. Die Wirtschaft wiederum hebt die Auslandserfahrung als für sie wichtige Qualifikation hervor. Auch vor dem Hintergrund des gemeinsamen Binnenmarkts leistet Erasmus somit einen wichtigen Beitrag.
Erasmus ist eines der sichtbarsten und populärsten Programme der Europäischen Union und erreichte heuer schon eine Auslastung von 99%. Deshalb ist es notwendig, zusätzliche Mittel für das Programm freizugeben. Studierende, die in den kommenden Monaten ihren Erasmus Aufenthalt starten, müssen so schnell wie möglich Klarheit bekommen.
Gerade jetzt dürfen wir nicht Verwirrung schaffen. Erasmus 2013 darf daher nicht mit einer Budgetlücke starten. Wir können es uns deshalb gerade jetzt nicht leisten, diesen Leuchtturm der europäischen Bildungs- und Beschäftigungspolitik zu beschädigen. Bildung ist das beste Rezept gegen Jugendarbeitslosigkeit.
Links zum Thema:
>> Presseaussendung vom 25. Oktober 2012
>> Plenardebatte in Strassburg „Ist ERASMUS in Gefahr?“
Der SPÖ-Europa-Abgeordnete Josef Weidenholzer kritisiert im Gespräch mit der futurezone, dass bei dem von der EU finanzierten Anti-Terror-Projekt „Clean IT“ zu stark Rücksicht auf die Interessen der Industrie genommen wird und die Bekämpfung des Terrorimus nur als Vorwand dient, um neue Überwachungsmöglichkeiten zu schaffen. Der EU-Abgeordnete will Bürger stärker in den Prozess der EU-Gesetzgebung miteinbeziehen.
Das von EU-Kommissarin Cecilia Malmström geförderte länderübergreifende Projekt „Clean IT“ soll einen Internet-Leitfaden für Unternehmen erarbeiten, mit dem „Terrorismus im Internet“ bekämpft werden soll. Sie haben zu dem Projekt eine Anfrage an die EU-Kommission eingebracht. Wie gefährlich ist das Projekt Ihrer Meinung nach?
Gefährlich ist vielleicht nicht das richtige Wort. Die Frage, die ich mir stelle ist: Warum werden solche Projekte außerhalb der normalen Diskussion innerhalb der EU unterstützt und finanziert? Wir befinden uns derzeit in einer Situation, in der es eher zu wenig Mittel gibt. Es wird überall darüber diskutiert, wo man im EU-Budget was einsparen kann. Umso absurder ist es dann, wenn da Aktivitäten gefördert werden, die nicht unmittelbar mit einem EU-Vorgang zu tun haben.
Im Februar 2013 sollen die Ergebnisse aus „Clean IT“ offiziell präsentiert werden, die Maßnahmen sollen dann als „Empfehlungen“ dienen. Sie kritisieren, dass bei dem Projekt mehr auf die Interessen der Industrie Rücksicht genommen wurde und die Stimmen der Netz-Community gar nicht gehört worden sind.
Dass man sich gewisser Expertisen bedienen muss ist ok. Wenn man aber bestimmte Akteure einlädt und andere nicht und wenn man dann vorhat, diese Meinungen in ein offizielles Ergebnis einmünden zu lassen, dann finde ich das sehr hinterfragenswert. Das hätte man einerseits viel transparenter und öffentlicher kommunizieren müssen und andererseits hätte man auch andere Stakeholders mitbeteiligen können. Es gibt ja, das wird der EU-Kommission ja nicht entgangen sein, auch eine sehr interessierte Internet-Öffentlichkeit für IT-Fragen. Mein Eindruck ist, dass sich die Neugier zu erfahren, was von dieser Seite kommt, in Grenzen hält.

Josef Weidenholzer in seinem Büro im EU-Parlament in Brüssel
Mit „Clean IT“ sollen Maßnahmen entwickleln werden, mit denen „Terrorismus im Internet“ bekämpft werden soll. Sind Ihrer Meinung nach zusätzliche Maßnahmen notwendig?
Natürlich gibt es Gefahren, die wir nicht kennen, aber es gibt bereits eine Reihe von Instanzen, die sich damit beschäftigen. Es gibt beispielsweise die Europol, die sich mit Terrorismusbekämpfung auseinandersetzt. Bei „Clean IT“ habe ich hingegen den Verdacht, dass man den Terrorismus nur vorschiebt, um viel mehr Kontrollmöglichkeiten in die Hand zu bekommen. Ich habe den Verdacht, dass das nicht ausschließlich von der Sache her zu rechtfertigen ist. Man hat die Instrumente dafür ja bereits. Der Verdacht liegt daher nahe, dass man sich etwas Anderes erwartet.
Das heißt, dass man mit einem Ausbau der Überwachung von Internet-Nutzern eigentlich andere Zwecke verfolgt?
Wir haben diese Erfahrung gemacht bei der Vorratsdatenspeicherung. Zunächst ist die Bekämpfung des Terrorismus im Mittelpunkt gestanden und man hat gemeint, dass man mittels solcher Daten terroristische Aktivitäten bekämpfen kann. Dann hat man mit diesen Daten aber nicht Terrorismus bekämpft, sondern hat die Daten für alle möglichen Straftaten herangezogen. Mittlerweile werden diese Daten in manchen Ländern wie Polen ganz exzessiv verwendet. Es können in Polen aber nicht zigtausende terroristische Aktivitäten stattfinden, die das rechtfertigen. Diese Gefahr sehe ich hier genauso, dass die Terrorismusabwehr nur als Vorwand herangezogen wird.
Ein anderes Beispiel sind Flugpassierdaten (PNR). Die Speicherung dieser Daten sollte zunächst auch nur dazu dienen, dass man Leute, die Flugzeuge kapern, abfängt. Mittlerweile werden die PNR-Daten allgemein genutzt und es ist nicht abzusehen, was mit den Daten, die zwar entpersonifiziert werden, gemacht wird. Da werden damit auch Bedrohungsbilder entwickelt und statistisch begründet und das hat alles mit dem ursprünglichen Zweck überhaupt nichts mehr zu tun.
Wo wird das gemacht?
Die USA haben einen richtigen Datenwulst. Die Daten werden zwar entpersonifiziert, aber ich kann alle möglichen Regressionen berechnen oder Zusammenhänge mathematisch darstellen.
In der EU wird derzeit die Datenschutzverordnung erarbeitet. Wie stehen Sie dieser gegenüber?
Die Kommission hat hier einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht, der in Details zwar kritisierbar ist, insgesamt aber in die richtige Richtung geht, eine gesamteuropäische Norm zu schaffen. Das große Problem ist, dass man nur für den privaten Sektor eine Verordnung machen will und dass man, was Polizeibehörden betrifft, nur von einer Richtlinie ausgeht. Das würde den Nationalstaaten Spielraum geben, aber ich glaube, dass dennoch eine Lösung aus einem Guß entstehen wird.
Ich glaube, dass Europa damit Standards setzen kann, die global verbindlich werden. Angeblich stammen ungefähr 40 Prozent des weltweiten Datenvolumens aus Europa und wenn man für diese 40 Prozent eine Regelung schafft, dann schafft man diese für den Rest automatisch mit. Kein globales Wirtschaftsunternehmen kann es sich leisten, Sonderregelungen zu entwerfen. Da hat Europa eine Chance, Maßstäbe zu setzen. In Europa ist das Bewusstsein für Datenschutz weltweit am höchsten entwickelt, vor allem der Schutz der individuellen Bürgerrechte, und das ist eine große Chance und Hoffnung.
Wie schätzen Sie hierfür die Grundstimmung im EU-Parlament ein?
Nach den bisherigen Diskussionen in den Ausschüssen im EU-Parlament kann man sagen, dass der generelle Umsetzungswille da ist. Nur beim Rat spießt es sich momentan ein wenig. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob es gelingt, das hohe Datenschutzniveau, das im Entwurf der EU-Kommission beabsichtigt war, auch einzuhalten. Beim Asylpaket wurden ja beispielsweise die schlechten Standards verbindlich gemacht. Bei der Datenschutzverordnung habe ich allerdings die Hoffnung, dass es auf einem hohen Niveau passiert.
Google hat im März diesen Jahres die Datenschutzregeln für 70 Google-Dienste, darunter YouTube, Gmail, Google Docs und Google+ vereinheitlicht. Die User-Daten können dadurch miteinander verknüpft werden. Das verstößt gegen geltendes EU-Recht. Glauben Sie, dass Google eine EU-Datenschutzverordnung ernst nehmen wird?
Ja, weil so große Konzerne wie Google sind grundsätzlich an Rechtssicherheit interessiert. Wir befinden uns derzeit allerdings noch in einer Phase, wo wir über das neue Recht diskutieren. In dieser Phase versucht Google, Druck aufzubauen und so viel wie möglich zu präjudizieren. Sobald eine rechtiche Situation da ist, würde ich Google so einschätzen, dass sie so ökonomisch denken und dass sie Gesetze nicht verletzen. Wenn Google die Gesetze nicht einhalten sollte, hat man zumindest die Möglichkeit, zu klagen.
So wie es Max Schrems bei Facebook gemacht hat? Wird die neue Verordnung hier tatsächlich mehr Möglichkeiten schaffen?
Ich glaube, dass es längerfristig ein Erfolg von Max Schrems war, ein Bewusstsein für Datenschutz geschaffen zu haben. Mit der neuen Verordnung wird der Gerichtsort nicht mehr Dublin sein, wenn ein österreichischer Facebook-Nutzer sich benachteiligt fühlt, sondern dann gibt es als klaren Gerichtsort Wien. In Dublin wäre es schwierig, das Verfahren weiterzubetreiben, das wäre sehr aufwendig. Mit der neuen Datenschutzverordnung werden klare Instanzen geschaffen und Tatbestände, die Gerichte ausjudizieren können.
Glauben Sie hat die EU-Kommission etwas aus dem Fall „ACTA“ gelernt? Es werden nach wie vor internationale Handeslabkommen im Geheimen verhandelt und die Entwürfe sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
Die EU-Kommission könnte etwas aus dem Fiasko lernen. Und zwar dass man Dinge besser vorbereitet und dass man die Öffentlichkeit miteinbezieht. Natürlich kann es Dinge geben, die einer besonderen Sensibilität bedürfen, aber wenn ich ein Handelsabkommen abschließe, das nachher für alle verbindlich ist, und dann sehe, wie direkte Persönlichkeitsrechte verletzt werden, ist es schon ein wenig absurd, das nicht auch zu kommunizieren. Gerade Handelsabkommen haben nur dann einen Sinn, wenn sie auch transparent sind.

Plenarsaal des Europaparlaments in Brüssel
Sie wirken nach einem Jahr parlamentarischer EU-Arbeit nach wie vor äußerst enthusiastisch und haben mit ACTA auch gleich einen „Sieg des Parlamentarismus“ miterlebt. Das Parlament erneuert sich aber regelmäßig und manche Themen ziehen sich jahrelang hin. Ist das nicht frustrierend?
Frustrierend ist es nur dann, wenn man zum Beispiel das Asylpaket beschließen muss. Hierzu hat die Geschichte bereits 2003/2004 begonnen und wir müssen jetzt den Sack zumachen. Man macht den Sack aber zu auf Basis dessen, was Leute, die schon lang nicht mehr da sind, gemacht haben. Das ist frustrierend, wenn man sieht, dass man nichts mehr verändern kann. In dem Fall muss ich es ablehnen, weil ich nicht akzeptieren kann, dass Menschen, die aus einer bedrohlichen Situation zu uns kommen, als erstes wieder eingesperrt werden.
Es gibt auch Dinge, von denen man genau weiß, dass man sie in einer Legislaturperiode nicht fertig machen kann. Nur deswegen kann man ja auch nicht gar nichts tun, man muss die richtigen Schritte setzen. Das ist das Wesen der Demokratie, dass es immer viele sind, die etwas zusammenbringen und dann manche Leute in einzelnen Phasen eine wichtige Rolle spielen und dass es dann wieder andere sein werden.
Wie wichtig ist es, die Arbeit, die Sie als EU-Abgeordneter machen, auch nach außen zu kommunizieren?
Für mich ist es eine große Herausforderung, die Grundzüge meiner Arbeit Menschen über Facebook so zu vermitteln, dass sie auch tatsächlich verstehen, was ich mache. Ich glaube, prinzipiell ist es für jeden Menschen, der politisch tätig ist, wichtig zu kommunizieren und zwar nicht nur Face-2-Face. Wenn man das nicht tut, ist man Autist und lebt in seiner eigenen Scheinwelt. Ich bin gerade dabei zu experimentieren, wie man Bürger in den Prozess des Gesetze Machens, des Law-Makings, miteinbeziehen kann.
Wie soll ein derartiges Law-Making mit Bürgern aussehen?
Wenn man sich Fußballspiele gemeinsam anschaut gibt es Public Viewing. So sollte auch das Gesetze Machen sein. Beim Public-Law-Making soll man sich aktiv beteiligen können. Ich möchte das im März nächsten Jahres bei ausgewählten kleineren Gesetzen ausprobieren und überlege gerade, wie man im Sinn von Liquid Democracy mit Wählern diskutieren kann. Zusammen mit der Informatik-Abteilung an der Universität Linz werden Tools entwickelt, um gemeinsam an Abänderungsanträgen zu arbeiten. Diese Tools sollen im März 2013 präsentiert und erstmals anhand eines Gesetzesentwurfs ausprobiert werden. Da ist Liquid Democracy sicherlich ein Vorbild, nur muss man das neu adaptieren.
Zur Person:
Josef Weidenholzer ist seit Dezember 2011 Europa-Abgeordneter für die SPÖ. Er ist unter anderem im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) sowie im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vertreten.
Vor 20 Jahren, am 15. Oktober 1992, wurde eine der vielversprechendsten Ideen Europas umgesetzt: die Grenzen innerhalb der EU wurden beseitigt und der europäische Binnenmarkt wurde geschaffen.
Doch wo sind wir jetzt, 20 Jahre später? Zweifelsohne wurden große Schritte gemacht, aber haben wir es auch verstanden dieses Konzept sozialer zu gestalten? Für uns jedenfalls nicht genug.
Mit dieser Broschüre gibt die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament Antworten auf die zehn wichtigsten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.
Hier die Broschüre zum Download (PDF):

Seit 2008 wird der Europäische BürgerInnenpreis für außergewöhnliches Engagement an EU-Bürgerinnen und Bürger vergeben. JedeR Abgeordnete kann eine Person, Gruppe oder Organisation dafür vorschlagen. Josef Weidenholzer nominierte das Projekt „Passo dopo Passo“ (italienisch: Schritt für Schritt), Gimmi Basilotta traf sich am 8. November 2012 mit den anderen GewinnerInnen sowie Europaabgeordneten im Europäischen Parlament in Brüssel, um die Auszeichnung entgegen zu nehmen.

Der stolze Preisträger Gimmi Basilotta und MEP Josef Weidenholzer vor der Projektvorstellung von „passodopopasso“

MEP Anni Podimata gratuliert Gimmi Basilotta bei der Überreichung des Europäischen BürgerInnenpreis im EU-Parlament in Brüssel
Link zum Projekt: http://www.viaggioadauschwitz.com/?lang=de
Am 21. September 2012 fand das 2. EU-Townhall Meeting im Musem Arbeitswelt in Steyr, Oberösterreich statt. PolitikerInnen diskutieren mit EU-BürgerInnen.
Die ORF Sendung Hohes Haus hat sich am 4. Oktober 2012 den Asylregelungen in Europa gewidmet. Seit über vier Jahren laufen die Verhandlungen über ein Gemeinsames Europäisches System. Vom ursprünglichen Vorhaben – einheitliche Regelungen und verbesserter Schutz für Asylsuchende – ist nicht viel übrig geblieben. Zu groß war der Druck der Innenminister in den Mitgliedsstaaten. Als größte Kritikpunkte an den neuen Bestimmungen beschreibt MEP Josef Weidenholzer, dass es für AsylwerberInnen kein Recht auf Zugang zum Gesundheitssystem gibt und dass durch die „Aufnahme-Richtlinie“ die so genannte „in Gewahrsamnahme“ legalisiert wurde, wonach AsylwerberInnen unter bestimmten Bedingungen in Haft genommen werden können.